– AUS DEN ERINNERUNGEN VON ZEITZEUGEN
VON DIETMAR WOLF, ERSCHIENEN IM TELEGRAPH – SONDERAUSGABE zum 8. Mai 2015 –
Nach der sowjetischen Winteroffensive stand die Rote Armee Ende Januar 1945 entlang von Oder und Neiße rund 80 Kilometer vor Berlin. Der Krieg ging in die letzte Phase. Die Eroberung Berlins und die endgültige Zerschlagung der faschistischen Machtzentrale waren das erklärte Ziel.
Bis Anfang April wurden rund 2,5 Millionen Soldaten, 6.000 Panzer und 7.500 Flugzeuge für den Angriff in Stellung gebracht. Ihnen gegenüber standen rund eine Million deutsche Soldaten, die sich aus Resten von Wehrmachtsarmeen, Einheiten der Waffen-SS und deren Hilfstruppen sowie aus improvisierten Verbänden von Polizei und Volkssturm zusammensetzten. Kaum 800 Panzer konnten die Verteidiger aufbieten, die zudem unter erheblichem Munitions- und Treibstoffmangel litten.
Am 16. April 1945 leitete die Rote Armee mit einem Zangenangriff auf Berlin das nahe Ende der Naziherrschaft ein. Die 1. Ukrainische Front unter Marschall Iwan Konew überrollte die deutschen Verteidigungsstellungen an der Lausitzer Neiße südlich von Berlin, während die 1. Weißrussische Front unter Georgij K. Schukow nach verlustreichen Kämpfen auf den Seelower Höhen die Stadt im Norden umging.1
Die Befreiung von Hohen Neuendorf gehörte zu den Kämpfen im Raum Oranienburg, der mit zum äußeren Verteidigungsring der Hauptstadt gehörte und in dem von deutscher Seite etwa 40.000 Soldaten der „Armeegruppe Steiner“, der „Volkssturmdivision Velten“ und der „SS-Totenkopfdivision Brandenburg“ stationiert waren. Die Einheiten der Roten und der Polnischen Armee im Raum Oranienburg-Sachsenhausen hatten die Aufgabe, die „Armeegruppe Steiner“, die sich befehlsmäßig vom Norden aus nach Berlin durchschlagen sollte, zurückzuwerfen. Die Kämpfe zogen sich bis zum 29. April hin. In diesem Zeitraum wurde neben Hohen Neuendorf auch Glienicke, Gemeinde und KZ Sachsenhausen, Lehnitz, Oranienburg, Birkenwerder und Germendorf befreit.
Am 22. April 1945 ist in Hohen Neuendorf der Krieg zu Ende. Am Abend des 20. April 1945 rückten die ersten Einheiten der Roten und polnischen Armee in den Oranienburger Raum vor. Am 22. April (nach anderer Aussage ist es der 21. April) wurde Hohen Neuendorf durch Einheiten der Roten Armee im Süden und durch die polnische 1. Infanteriedivision „Tadeusz Kościuszko“ im Norden befreit. Zwei polnische Flakstellungen verblieben in der Briesestraße, um den geplanten Durchbruch deutscher Truppen über die Havel zu verhindern. Dabei fielen 11 polnische Soldaten, die zunächst in der Ernastraße bestattet und 1954 auf den Friedhof Hohen Neuendorf umgebettet wurden. Seitdem finden regelmäßig zum polnischen Nationalfeiertag und zum Tag der polnischen Armee Kranzniederlegungen auf dem Friedhof statt (Stand 1978).2
Über den Ablauf der Selbstbefreiung gibt es verschiedene, teils abweichende Berichte und Zeitzeugenerzählungen. Die Sozialdemokratin Ilse Semrau erinnert sich: „Am 20. April 1945 gegen Abend wurde in Hohen Neuendorf ein Treck zusammengestellt, der sich hinter die Havel zurückziehen sollte. Dabei taten sich Lehrer Hornemann (als Parteifunktionär und Volkssturmführer in voller Naziuniform) und Herr Hundeshagen besonders hervor. Hornemann begleitete den Treck mit dem Fahrrad und wollte offensichtlich zurückkehren. Am nächsten Tage wurde er tot auf dem Stolper Feld gefunden. Die Einwohner, die mit dem Treck mitgezogen waren, kehrten erst Wochen später zurück.“3
Die Hitler-Jugend musste zum Appell antreten und wurde zum bewaffneten Kampf gegen die „Russen“ aufgerufen. Während sich eine Gruppe SS im Rathaus verschanzte, errichtete der Volkssturm Panzersperren am Ortsausgang in Richtung Hennigsdorf. Hohen Neuendorf sollte bis zum letzten Blutstropfen gehalten werden. Doch es kam alles anders. Denn es gab im Ort eine aktive Widerstandgruppe aus Kommunisten, Sozialdemokraten und Parteilosen. Diese Gruppe wagte die Selbstbefreiung. Ein unmittelbar nach der Befreiung abgefaßter Gemeindebericht für den Zeitraum 21. April bis 16. Juni 1945 schildert diese Aktion: „Vor dem Einrücken der Roten Armee, in der Nacht vom 21. zum 22. April 1945, entwaffnete eine antifaschistische Gruppe das von der SS besetzte Rathaus. Nach Beseitigung des Widerstandes wurde das Rathaus in den Verteidigungszustand versetzt. Mit der Entwaffnung der Faschisten im Orte sowie der Waffen-und Munitionssuche wurde zugleich die Verhaftung der Faschisten im Rathause vom politischen Leiter (Bürgermeister) bis zum politischen Leiter des Bezirks vorgenommen. Diese Aktionen laufen auch in Zukunft weiter. Unsere Gruppe hatte die Aufgabe, den Volkssturm zu bewegen, die Waffen niederzulegen und die Panzersperren zu öffnen. Diese Aktion ist restlos geglückt, ein Kampf gegen die Rote Armee fand nicht statt. Die erste Panzerspitze der Roten Armee, die sich von Bernau über Bergfelde nach Hohen Neuendorf bewegte, konnte nach Verständigung zwischen der antifaschistischen Gruppe und dem Panzerkommandanten, daß der Ort von uns gesichert und die weiße Fahne auf dem Rathaus gehißt ist, ihren Vormarsch über Hohen Neuendorf fortsetzen.“4
Was die kampflose Übergabe bzw. Befreiung von Hohen Neuendorf betrifft, unterscheiden sich die Beschreibungen im Gemeindebericht mit den Erinnerungen von Zeitzeugen. Danach hätten sich in der Stolper Straße Hitlerjungen verschanzt, die den sowjetischen Soldaten kurzzeitig Widerstand leisteten. Frau Semrau berichtet: „In der Nacht vom 20. zum 21. April gab es Kämpfe in der Stolper Straße zwischen Hohen Neuendorfer Hitlerjungen und russischen Panzern. Die Panzer sind wahrscheinlich die Stolper Straße entlang aus Richtung Hennigsdorf gekommen. Die Panzersperre, die an der Brücke unter der Bahn in der Berliner Straße errichtet worden war, hatte sie jedenfalls nicht gestört. Den Widerstand der Hitlerjungen hatte Herr Werk angestiftet, vielleicht auch Lebensmittelhändler Wolfert. Wolfert war Nazi und lief oft in brauner Uniform herum. Sein Laden war in der Stolper Straße, Ecke Florastraße; bei ihm war ich früher schon zum Lebensmittelmarkenaufkleben verpflichtet worden. Bei diesen Kämpfen wurden Helwig und noch ein weiterer Hitlerjunge getötet, die Gaststätte Fichtenhain und das Haus von Werk zerstört.“5
Die Beschreibungen von Ilse Semrau werden durch die Erinnerungen von Heinz Becker, ebenfalls aus Hohen Neuendorf, bestätigt. „Am Tag nach der Einnahme Hohen Neuendorfs, verließ ich morgens bei schönem Wetter unser Haus und hatte die erste Begegnung mit einem russischen Soldaten. Ich ging dann durch den Hainweg in Richtung Berliner Straße. Im Hainweg lag ein toter SS-Mann, seine Maschinenpistole hing zerbrochen an einem Baum.
An der Ecke Berliner Straße/Stolper Straße lagen vier tote Hitlerjungen, einer davon war mein HJ-Führer, den ich an der besonderen Färbung seiner Augenbrauen erkannte. In der Stolper Straße waren abgeschossene russische Panzer, über die Anzahl kann ich nichts sagen. Hohen Neuendorf wurde aus der Hennigsdorfer Richtung eingenommen, die Panzer kamen die Stolper Straße entlang und wurden von den Hitlerjungen aus den Häusern heraus bekämpft. Diese Kämpfe hatten offensichtlich in der Nacht zuvor stattgefunden und waren nur kurz. Innerhalb von drei Stunden war in Hohen Neuendorf der Krieg erledigt. Meine Eltern hatten die Situation richtig eingeschätzt und mich so beeinflußt, daß ich den Befehl zum Treffen für den Kampf um Hohen Neuendorf verweigert hatte, zu Hause geblieben war und an diesen Kämpfen nicht teilgenommen hatte. Das rettete mir wahrscheinlich das Leben.
Von der Stolper Straße ging ich zum Rathaus. Dort war ein schweres Maschinengewehr in Stellung mit zwei Zivilisten mit roten Armbinden und solchen Mützen, daß ich sie für deutsche Kommunisten hielt. Auf dem Rathaus wehte eine weiße Fahne, die später von einem deutschen Flugzeug abgeschossen wurde.“6
Nach der Befreiung werden führende Nazis, wie Paul Jacob und Ortsbauernführer Hornemann-Scheider, von der Sowjetarmee in Gefangenschaft genommen. Aus der Ruhwald- und Hubertusstraße werden 75 Familien umquartiert, weil in die dortigen Häuser die Rote Armee einzieht. Später wird nur noch das Gebäude des späteren Kinderheimes „Sonnenhaus“ in der Berliner Straße in Beschlag genommen. In diesem Gebäude bringt man die Kommandantur der sowjetischen Armee unter. Die polnische Armee ist im Mädchenviertel einquartiert.
Der Kommunist Ernst Nowacki wird zum Bürgermeister der Gemeinde ernannt. Es werden ehrenamtliche Ausschüsse gebildet, die die Verwaltung kontrollieren und gleichzeitig die Interessen der Bürger beim Magistrat zur Sprache bringen sollen. In Hohen Neuendorf gründen sich Ortsgruppen der KPD, SPD und der Liberaldemokratischen Partei (LDPD).
Ende Juli/Anfang August 1945 wird der Kommandant der sowjetischen Armee von Hohen Neuendorf abgezogen. Die Bezirkskommandantur befindet sich nach wie vor in Birkenwerder. Als Kommandant ist Major Postowski eingesetzt.
Am 1. August wird eine Kohlenstelle eingerichtet. Da jedoch nicht mit ausreichend Kohle gerechnet wird, organisiert diese Kohlenstelle die Versorgung mit Holz. Die Gemeinde bekommt im Forst Elseneck Holz zum Schlagen – jeder Haushalt erhält bald darauf 1/2 Meter Holz. Die im Dezember gelieferten 170 Zentner Kohlen werden an Gärtnereien, Wäschereien, Schulen und Ärzte verteilt.
Am 14. August 1945 werden auf einer Versammlung alle Lehrer, die Mitglied der
NSDAP waren, entlassen. Für Hohen Neuendorf bedeutet das, daß es plötzlich nur noch zwei männliche und vier weibliche Lehrer gibt. Diese werden aber bereits im September 1945 durch 8 Neulehrer verstärkt. Im Oktober 1945 beginnt, per Befehl der SMAD (Sowjetische MilitärAdministration in Deutschland), der Schulunterricht. Neues Unterrichtsfach ist nun Russisch.
Am 6. September wird eine Verordnung über die Bodenreform erlassen, in deren Folge sich in Hohen Neuendorf die Kommission der Bodenreform bildet. Bis zum 22. Oktober werden sechs Wirtschaften von „Kriegsverbrechern und aktiven Faschisten“ enteignet. Das ist eine Fläche von insgesamt 26,55 ha, davon bestellte Fläche 2,75 ha. 137 Anträge auf Landzuteilung liegen vor, davon 22 von landarmen Bauern und 115 von Landlosen (darunter Landarbeiter und Kleinpächter). Da aber in Hohen Neuendorf keine größeren landwirtschaftlichen Flächen enteignet wurden, werden zunächst 27 Bewerber für Neubauernstellen in Schönfließ angesetzt. Im November 1945 sind es bereits 30 Neubauern aus Hohen Neuendorf. Jeder von ihnen hat ca. 5 ha Land und 2 ha Wald aus der Aufteilung des Gutes Schönfließ erhalten. Bis zum 25. Februar 1946 erhält Hohen Neuendorf insgesamt 38,55 ha. Hiervon werden verteilt: an einen landarmen Bauern 4,1 ha Ackerland, an 130 landlose Industrie- und Landarbeiter 14 ha. Der Rest fällt an die Gemeinde, u. a. für das Schulgelände.
Seit Einzug der Roten Armee verfügen die Gemeinde und die Bürger lediglich über Pferdefuhrwerke (4 Doppelgespanne und 4 Einspänner). Im September 1945 erhält Hohen Neuendorf die erste Hanomag-Zugmaschine, die zweite im Dezember.7
Frau Elfriede Siebert schrieb in dieser Zeit Tagebuch und beschreibt darin die ersten Monate in Hohen Neuendorf nach der Befreiung:
30. April: „Es sollen alle Radios, Schieß- und Stichwaffen, Vervielfältigungsapparate, Fotoapparate abgegeben werden.“
2. Mai: Verteilung von Lebensmittelkarten in Birkenwerder, „doch darauf haben sie noch nichts bekommen. Hier in unserer Straße sind wir noch nicht registriert.“
3. Mai: Suche nach versteckten Soldaten, „es soll eine Truppe SS hier in den Wäldern gewesen sein“; es wurde geschossen.
4. Mai: „Wir bekamen heute Brot auf Marken … Zwei Brote auf neun Mann.“
5. Mai: Die Bevölkerung soll sich um 12.00 Uhr vor dem Rathaus versammeln, der Kommandant will eine Ansprache halten. „Als viele tausend Menschen vorm Rathaus versammelt waren, kam der Kommandant, es wurde ein Schriftstück verlesen, die Verurteilung eines Hohen Neuendorfers, der vorhandene Waffen, Rundfunk- und Fotoapparate nicht abgeliefert hatte. Nach Verlesen des Urteils ist er vor der Bevölkerung erschossen worden.“
6. Mai: Der Erschossene war ein Flüchtling. In dem Haus, wo er untergekommen war, wurde der Koffer des Hausbesitzers mit Uniformstücken und Waffen gefunden. Seiner Erklärung, daß es nicht seine Sachen wären, wurde nicht geglaubt.
13. Mai: „Der Kaufmann Wolfert ist einem Schlaganfall erlegen, man hat ihm die Tochter vergewaltigt.“ Nach einem Bericht hat sich Dr. M. mit Familie erschossen, er war „wohl Volkssturmführer“.
15. Mai: Sammlung einer Rotkreuzschwester für das neue Krankenhaus, das in der Jugendherberge eröffnet werden soll.
20. Mai: „Wir haben heute das erstemal Fleisch bekommen, 159 g seit Wochen, 5 Pfund Kartoffeln und wieder 1050 g Brot, 50 g Zucker, Mehl und sogar 50 g Salz. Der russische Kommandant sagt, daß dieses hier die schlechtversorgteste Gemeinde sei. Berlin ist im Augenblick besser dran.“
9. Juni: „Die Bahn fängt an zu fahren. Morgens und abends geht ein Zug bis Stettiner Bahnhof und zurück bis Lehnitz (?).“
13. Juni: „… seit Mittag finden wieder furchtbare Explosionen statt, das Haus erschüttert bis auf den Grund.“
12. August: „An Nahrungsmitteln gibt es nichts außer Brot, dieses auch nur mit großer Mühe.“
1. September: „Es kommt jetzt Brot von Berliner Großbäckereien, die Bäcker hier haben alle Backverbot, sie sollen zuviel verschoben haben, daher diese Änderung.“
18. Oktober: „Wir müssen uns alle untersuchen lassen, der Gesundheitszustand der Bevölkerung ist miserabel, Oranienburg ist noch gesperrt.“
17. November: „Wir dürfen nur 20 kWh elektrisches Licht im Monat verbrauchen.“
19. November: „Wir haben eine extra große Überraschung bekommen, ich muß noch einmal Gemeindesteuern bezahlen, sie sind einfach verdoppelt worden.“
Weihnachten: „Wieder kommen neue Flüchtlinge nach Hohen Neuendorf.“8
Hohen Neuendorf war mit Beginn der Naziherrschaft ein aktiver Hort sozialdemokratischen und kommunistischen Widerstands. Die Widerstandsgruppe „Nordbahn“ unter Führung des Sozialdemokraten Otto Scharfschwerdt wirke in der ganzen Region bis in den Norden Berlins. Zur Leitung der Gruppe gehören neben Otto Scharfschwerdt, Hermann Schlimmer (Berlin), Erich Hahn (Birkenwerder), Erich Wienig (Birkenwerder) und Kurt Noack (Hohen Neuendorf).
1937 zerschlagen die Nazis die Widerstandsgruppe. 40 Aktivisten wird der Prozeß gemacht. Kurt Noack erhält eine zweieinhalbjährige Zuchthausstrafe wegen Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens, die er im Zuchthaus Brandenburg absitzt. Nach seiner Entlassung beteiligt er sich weiter am Widerstand in Hohen Neuendorf und nimmt eine wichtige Rolle bei der Selbstbefreiung seines Heimatortes am 20./21. April 1945 ein.9
Unmittelbar nach der Befreiung von Hohen Neuendorf entsteht dort eine neue SPD-Ortsgruppe, deren Vorsitzender Kurt Noack wird. Er wirkt in Kommissionen wie dem Antifa-Ausschuß oder der Bodenreform-Kommission mit. Doch schon im August 1945, infolge von Querelen zwischen KPD und SPD, gerät Kurt Noack ins Blickfeld der sowjetischen Administration. Als im März 1946 die Vereinigung von KPD und SPD vorbereitet wird, weigert sich Kurt Noack, dieser Vereinigung zuzustimmen.
Am 3. Dezember 1948 wird Kurt Noack, zusammen mit seinem Sohn Ernst Noack, von dem NKWD (Volkskommissariat für innere Angelegenheiten) verhaftet und nach Sibirien deportiert. Sein Enkel Heinz Noack erinnert sich: „Leute von der GPU10 sind an jenem Abend gekommen und haben ihn abgeholt mit der Begründung, sie brauchten eine Aussage von ihm. Er solle seine Sachen nehmen, und meiner Großmutter wurde gesagt, er solle etwas Warmes zum Anziehen mitnehmen. Es wurde eine Wohnungsdurchsuchung vorgenommen, und sie wollten auch Papiere, Kassen und alles, was ihnen suspekt war, sehen. An diesem Abend, als die Leute noch im Haus waren, kam der Ernst Noack, der in Reinickendorf wohnte, um seine Eltern zu besuchen. Er hatte unter anderem zufällig ein Exemplar der Westzeitung Telegraf dabei. Allein aus dem Grund, daß er eine solche Zeitung in die damals sowjetische besetzte Zone eingeführt hatte, war das schon eine Straftat. Darüber hinaus wurde ihm gesagt, er solle mitkommen und die Aussagen von meinem Großvater bestätigen, dann könne er wieder nach Hause gehen. Meine Großmutter ist dann auch mitgekommen. Damals war diese Stelle, wo er dann zum Verhör gebracht wurde, gegenüber der Grundschule, ich glaube es war die Berliner Straße. Da war unten ein Büro des Politbüros oder so etwas ähnliches, und da hat er zuerst gesessen. Und da war die Großmutter zuerst auch dabei und hat ihren Kurt aber nicht mehr gesehen. Und da hat ein Beamter dann gesagt, sie solle doch nach Hause gehen, er käme heute nicht mehr wieder.
Kurt und Ernst Noack sind dann nach Sachsenhausen gekommen. Kurt Noack wurde nach Sibirien irgendwo am Baikalsee verschleppt, und Ernst Noack kam nach Bautzen. Nach welchem Zeitraum sie verschleppt wurden und aus welchem Grund sie getrennt wurden, kann ich nicht sagen. Es ist mir auch nicht bekannt, ob ein Gerichtsverfahren oder eine Verurteilung stattgefunden hat. Ernst Noack kam 1956 aus Bautzen zurück.
Später ist ein Herr gekommen, den ich nicht namentlich kenne und auch nicht sagen kann, wann er gekommen ist. Der hatte eine Art Spickzettel dabei, den man sich als Häftling untereinander in den Gefängnissen zusteckte, wenn einer entlassen wurde. Der hatte auf dem Papier den Namen und die Adresse und ist dann nach Hohen Neuendorf zu meiner Großmutter gekommen und hat gesagt, daß Herr Kurt Noack dort verstorben ist. Er ist wahrscheinlich durch die schwere Zwangsarbeit, er war immerhin schon 70 Jahre alt, verstorben. Was das für ein Lager war und welche Zwangsarbeit dort verrichtet wurde, kann ich nicht sagen.“11
1 https://www.dhm.de (Die Schlacht um Berlin 1945)
2 Chronik der Gemeinde Hohen Neuendorf
3 Ilse Semrau, Hohen Neuendorf, Scharfschwerdtstr. 2: Auskünfte zur Ortsgeschichte von Hohen Neuendorf
4 Protokoll über die Parteiarbeiter-Konferenz der Kommunistischen Partei, Ortsgruppe Hohen Neuendorf, am 13. Juli 1945
5 Ilse Semrau, Hohen Neuendorf, Scharfschwerdtstr. 2: Auskünfte zur Ortsgeschichte von Hohen Neuendorf
6 Herr Heinz Becker (Jahrgang 1890): 1945 wohnhaft in Hohen Neuendorf, Elfriedestraße 26 (2. Mai 1995)
7 Chronik der Gemeinde Hohen Neuendorf
8 Die Schweizerin Elfriede Siebert lebt in Hohen Neuendorf und verwaltet ab Februar 1945 das Haus ihres in die Schweiz übergesiedelten Sohnes, des Zahnarztes Gustav von Muralt. In dieser Zeit führt sie Tagebuch, das auszugsweise 1986 in der Schweizer Zeitung Die Weltwoche veröffentlicht wurde (Nr. 51 und 52, 19. und 26. 12. 1986). Die folgenden, einen Überblick über die Ereignisse und Einblicke in die Lebensumstände der unmittelbaren Nachkriegszeit (April bis Dezember 1945) gebenden Schilderungen entstammen (in wörtlicher Rede bzw. sinngemäß) diesen Aufzeichnungen. / Chronik der Gemeinde Hohen Neuendorf
9 Aus dem Leben des Arbeiterfunktionärs Otto Scharfschwerdt (Veröffentlichungen aus der Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung des Kreises Nr. 1/1972)
10 Aus der (O)GPU wurde bereits 1934 der NKWD (Volkskommissariat für innere Angelegenheiten). Im deutschen Sprachgebrauch wurde noch Jahre später (erst in Nazi-Deutschland, nach 1945 dann in beiden Teilen Dtl.) von der „GPU“ gesprochen, (OGPU = Vereinigte Staatliche Politische Verwaltung, 1922-1934, Nachfolgeorganisation der Tscheka, 1917-1922).
11 Bericht von Heinz Noack, Enkel von Kurt Noack, über das Schicksal von Kurt Noack ab dem 21./22. April 1945 (29.12.1997)

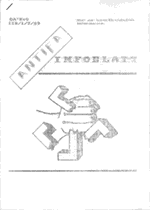
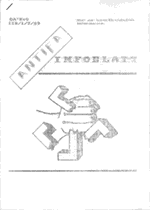 Antifa Infoblatt Ostberlin, Nr. 1
Antifa Infoblatt Ostberlin, Nr. 1 Antifa Infoblatt Ostberlin, Nr. 2
Antifa Infoblatt Ostberlin, Nr. 2 Antifa Infoblatt Ostberlin, Nr. 3
Antifa Infoblatt Ostberlin, Nr. 3